Bloomsbury 2017, 343 Seiten
Gelesen schon lang vor dem diesjährigen Man Booker Prize für Saunders. Ein Fan, weil dieser Mann einfach so grandios anders, eigen, eindringlich und gut schreibt, dass jeder, der selbst mit Worten zu tun hat, sich wie ein kleingeistiger Stümper vorkommen muss. Was wir auch sind – im Vergleich.
Seine Kurzgeschichten ZEHNTER DEZEMBER habe ich hier schon hymnisch besprochen und so war die Vorfreude groß, als Anfang des Jahres sein erster Roman erschien. Sofort in England bestellt, in einem Rutsch gelesen – und dann ermattet liegen lassen, unfähig Worte für dieses Erlebnis zu finden.
Aber das Gefühl ist heute noch so frisch, wie vor fünf Monaten – was ja allein schon für die Kraft dieses Buchs spricht. Inzwischen hab ich weitere Bücher gelesen, dazu hunderte Seiten Magazine, Zeitungen, Blogs. Ich habe Filme und Serien gesehen und viel geschrieben. Aber LINCOLN IN THE BARDO pulsierte und starrte mich in den letzten Wochen aus dem Regal geradezu an. Das Buch hat die Kraft, Tote zu erwecken.
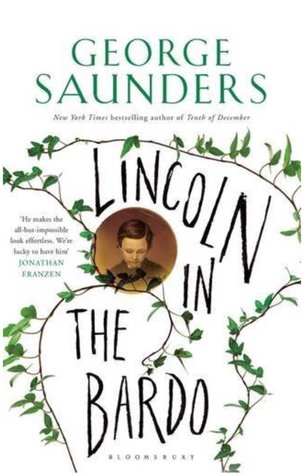 Die Handlung zu erzählen, fällt schwer, weil es nicht die Story ist, die so brillant ist. Es gibt kaum eine. Ich glaube auch nicht die Saunders-Stimme (für dieses Buch besser gesagt: die Stimmen), also nichtmal die Sprache, machen das Buch so besonders; und auch nicht die zunächst wirre Struktur mit duzenden Figuren. Was das Buch ausmacht, ist all das zusammen – und das Thema, das nie angesprochen, aber darüber schwebt. Hoffnung.
Die Handlung zu erzählen, fällt schwer, weil es nicht die Story ist, die so brillant ist. Es gibt kaum eine. Ich glaube auch nicht die Saunders-Stimme (für dieses Buch besser gesagt: die Stimmen), also nichtmal die Sprache, machen das Buch so besonders; und auch nicht die zunächst wirre Struktur mit duzenden Figuren. Was das Buch ausmacht, ist all das zusammen – und das Thema, das nie angesprochen, aber darüber schwebt. Hoffnung.
Die Ausstrahlung der Geschichte, was in ihr und um sie herum wabert, was der Roman in seinen unzähligen Stimmen erzählt, während er eigentlich von etwas anderem erzählt. Das Buch umkreist mit dutzenden Stimmen palavernd die großen Themen aus Literatur und Leben: Tod. Verlust. Trauer. Liebe. Väter. Mütter. Einzigkeits in der Masse im Diesseits. Die nahen Menschen, die uns ausmachen.
Die New York Times hat einen interaktiven Film zum Buch machen lassen, der ein wenig dieses „Alles“, den zentralen Moment und die Stimmen aus Saunders Buch wiedergibt.
Vordergründig geht es – wie der Titel andeutet – um den Tod des Sohns von Präsident Lincoln. Es ist Bürgerkrieg 1862 in den USA, als der geliebte, feinsinnige, freundliche 11-jährige Willie stirbt und beerdigt wird. Lincoln, so erzählt man, hat diesen Tod nicht verwinden können, den Tod des einen, während 1000ende in seinem Namen auf dem Schlachtfeld starben. Er soll mehrmals zum Friedhof gegangen sein, seinen Sohn aus der Gruft geholt und in seinen Armen gewiegt haben.
Es gibt im Buch (fiktionale) Zitate aus (fiktionalen) Büchern von Zeitgenossen, die Lincoln, den Tod des Sohns, die Stimmung im White House und weitere Diesseits-Details erzählen. Und es gibt die Friedhofsstimmen. Dort, im Limbo, in einer Zwischenwelt (im Tibetanischen Totenbuch „Bardo“ genannt), harren die „Seelen“ aus. Auch Willie Lincoln. Sie alle wollen nicht gehen, haben noch Dinge zu klären, oder glauben das zumindest, sie müssen noch etwas erledigen, sind im falschen Moment oder ohne es zu realisieren gestorben, wollen ihre geliebte Frau, ihre Kinder, ihren Mann, ihren Garten oder auch ihren Peiniger nicht einfach zurücklassen.
es gibt die Friedhofsstimmen. Dort, im Limbo, in einer Zwischenwelt (im Tibetanischen Totenbuch „Bardo“ genannt), harren die „Seelen“ aus. Auch Willie Lincoln. Sie alle wollen nicht gehen, haben noch Dinge zu klären, oder glauben das zumindest, sie müssen noch etwas erledigen, sind im falschen Moment oder ohne es zu realisieren gestorben, wollen ihre geliebte Frau, ihre Kinder, ihren Mann, ihren Garten oder auch ihren Peiniger nicht einfach zurücklassen.
Zugleich verweigern sie auf eine abstruse Art überhaupt die Erkenntnis tot zu sein. Obwohl sie, wie Vampire ohne Blutdurst, jeden Morgen in ihre Särge, ihre „sick box“ und in ihre verfallenden Körperhüllen, zurückkehren müssen.
Nachts sind sie alle unterwegs, verbünden sich, leben dort auf dem Friedhof und sind die Typen, die sie auch im Leben waren: Gauner, Liebende, Beamte, unschuldige Kinder, vergewaltigte Sklavinnen, hohe Herren, feine Damen, Schläger und Gelehrte, Denker und Dummköpfe. Aber natürlich ist es keine Geistergeschichte.
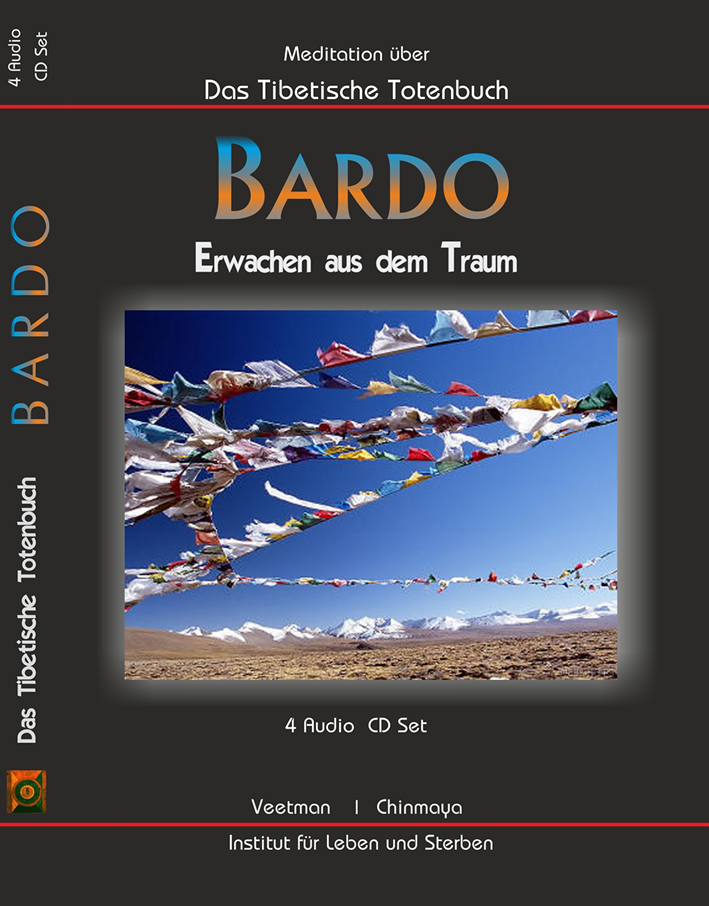
Mit eigentümlichen Dialekten, schlechtem Englisch, hochgestochenem Englisch, sprechen diese Menschen, rüde polternd oder leise und abwägend – je nach Typ. Ein Kaleidoskop, ein Gewimmel aus Menschen und Schicksalen, Charakteren, Hoffnungen und vergangenen Leben. Während die Welt einfach weitergeht und sie vergessen werden und verrotten. Das aber nicht wahrhaben wollen und bleiben. Und sich nur um sich selbst drehen und die Frage: Warum.
Als der tieftrauernde Lincoln eines nachts auf den Friedhof kommt und die Leiche seines Sohnes aus dem Grab holt und in seinen Armen wiegt, mit ihm spricht, gerät der gesamte Friedhof, geraten alle Bardo Seelen in Aufruhr. Da ist einer, der sie doch liebt, der sie sucht, der ihnen nah sein will. Das nährt die Hoffnungen, ihre Angehörigen, Geliebten könnten kommen und das gleiche tun. Dass sie noch zu etwas gut sind. So.
Es ist dieser Moment, der das Zwischenreich erschüttert:
„The boy`s gaze moved pas us.
hans vollmann
He seemed to catch sight of something beyond.
roger bevins iii
His face lit up with joy.
hans vollmann
Father, he said
the reverend everly thomas“
 Es sind diese drei Stimmen auch, die im Buch den meisten Raum bekommen. Drei Männer mit ihren eigenen Sorgen, die ausführlich von ihrem Moment des Sterbens erzählen und warum sie im Bado bleiben. Sie gehören zu den ältesten Bewohnern, wollen dem Jungen aber gern helfen. Er soll gehen können. Er soll nicht bleiben. Auch wenn das sie selbst der unangenehmen Erkenntnis tatsächlich tot zu sein, nah bringt. Sie werden in Lincolns Körper eindringen und ihn zum Weitermachen, zum Retten der amerikanischen Nation überhaupt befähigen. Und dem kleinen Willie Väter sein.
Es sind diese drei Stimmen auch, die im Buch den meisten Raum bekommen. Drei Männer mit ihren eigenen Sorgen, die ausführlich von ihrem Moment des Sterbens erzählen und warum sie im Bado bleiben. Sie gehören zu den ältesten Bewohnern, wollen dem Jungen aber gern helfen. Er soll gehen können. Er soll nicht bleiben. Auch wenn das sie selbst der unangenehmen Erkenntnis tatsächlich tot zu sein, nah bringt. Sie werden in Lincolns Körper eindringen und ihn zum Weitermachen, zum Retten der amerikanischen Nation überhaupt befähigen. Und dem kleinen Willie Väter sein.
“One feels such love for the little ones, such anticipation that all that is lovely in life will be known by them, such fondness for that set of attributes manifested uniquely in each: mannerisms of bravado, of vulnerability, habits of speech and mispronouncement and so forth; the smell of the hair and head, the feel of the tiny hand in yours—and then the little one is gone! Taken! One is thunderstruck that such a brutal violation has occurred in what had previously seemed a benevolent world.“
Der Präsident wird noch zweimal zum Friedhof kommen, Willie selbst wird in Folge eine Art Portal ins Diesseits für all die Untoten, die nach Antworten und Auswegen suchen. Sie bedrängen ihn mit Fragen. Und einige sind bereit, loszulassen.
Wie tieftraurig dieses Buch ist manchmal, wie witzig und klug dann wieder, wie geheimnisvoll und klar zugleich – ein Ereignis. Mir fällt kein anderes Lob ein.
Lincoln als eine Art Jesus Figur, sowohl politisch für das Land, wie in diesem Buch. Weil sein Verhalten, die Macht seiner Liebe für den Sohn, in einer Art umgedrehten Gott-Jesus Verhältnis steht. Er gibt hier Hoffnung den Toten, nicht den Lebenden. Im Diesseits führten seine Entscheidungen zu vielen Toten. Gott opferte laut Neuem Testament Jesus, seinen Sohn, Lincoln will seinen Sohn nicht gehen lassen und dann führt genau das zur Erlösung vieler gefangener Seelen. They move on.
Dieser Roman erzählt auf vielen Ebenen von der Schönheit des Lebens, vom Miteinander, das uns ausmacht, von der Kraft der Hoffnung. Und die ist nicht zu trennen von Tod, Verlust und der Flüchtigkeit des Moments.
Er erzählt von Individuen, in einer Welt voll Toten, in der wie bei uns jeder vor allem mit sich selbst beschäftigt ist – bis jemand wie Lincoln kommt und seinen Sohn aus dem Grab holt – und ein Autor wie Saunders uns aus der Lese-Lethargie und den Roman aus dem Abgesang.
Mein Buch des Jahres 2017. Ganz groß!